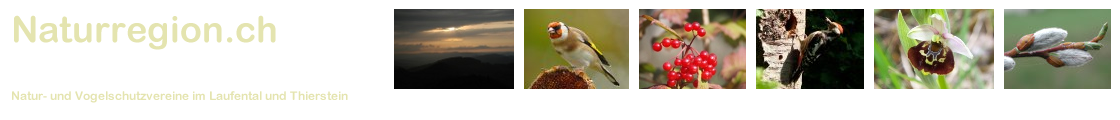Spinne des Jahres 2005
Proklamation durch die Arachnologische Gesellschaft e.V. (AraGes) am 09.01.2004 www.arages.de
Wer kennt nicht das verbreitete Zerrbild von Spinnen:
Sie sind schwarz, langbeinig, haarig - einfach gruselig und obendrein noch gefährlich giftig! Alles falsch, wie uns das Beispiel der Spinne des Jahres 2005 zeigt:
Die Zebraspringspinne.
Dieses putzige Tierchen ist gerade mal etwa einen halben Zentimeter (4 - 7 mm) gross. Es ist wie ein Zebra schwarz-weiss gebändert. Auf seinen acht Beinen bewegt es sich am liebsten an sonnigen, warmen Plätzen wie südexponierten Hausfassaden fort. Von blossem Auge kaum erkennbar, unter der Lupe oder auf der Makroaufnahme aber umso auffälliger sind die stark vergrösserten vorderen Mittelaugen.
Naturregion - Natur- und Vogelschutz im Laufental / Thierstein
Wissen
Wir staunen regelmässig über unsere Natur. Was Tiere leisten oder wie sie leben und überleben, oder sich verbreiten
Manche unserer Mitglieder haben Berichte geschrieben und geben hier gerne ihr Wissen weiter.
Haben Sie einen Bericht, gerne veröffentlichen wir diesen.
Wespenspinne
| 1. Portrait der Wespenspinne Die Wespenspinne ist eine der attraktivsten einheimischen Spinnen. Mit bis zu 2cm Körperlänge (Weibchen, Männchen werden nur ca. 5mm gross!) und den wunderbaren Radnetzen in der Vegetation gehören sie auch zu den wenigen der über 1.000 einheimischen Spinnen, welche überhaupt wahrgenommen werden. Aus diesem Grund hat die Arachnologische Gesellschaft e.V. für das Jahr 2001 diese Spinnen als "Spinne des Jahres" ausgerufen. Es geht bei dieser Wahl nicht um den Schutz einer seltenen Art, sondern darum die Spinnen und ihre Stellung in der Natur, bei der Bevölkerung zu festigen. Sie ist durch zwei Merkmale leicht zu erkennen: zum einen trägt sie auf dem Hinterleib Querstreifen aus gelben, weißen und schwarzen Linien, was ihr den deutschen Namen Wespenspinne einbrachte. Ein zweites Merkmal findet sich im Netz der Spinne: ein weißes Zickzackband aus eng beieinander gewobenen Fäden verläuft senkrecht durch das Radnetz der Wespenspinne. |
 |
| Die Wespenspinne sitzt kopfunter in der Netzmitte. Ein auffälliges Zickzackmuster aus weisser Spinnseide zieht sich von unten nach oben durchs Netz. Bild Johannes Spaar |
Die Wespenspinne war früher bei uns relativ selten. Seit ca. 30 Jahren werden sie über ganz Europa von Südwesten her immer häufiger festgestellt. Die Ursache für diese Ausbreitung ist nicht bekannt. Die Wespenspinne liebt wärmebegünstigte Standorte mit einer strukturreichen Vegetationsschicht. Im Gegensatz zu der sehr häufigen Kreuzspinne, die ihre Netze gerne auch in Fensternischen baut, errichtet die Wespenspinne ihre Radnetze meist in Bodennähe. Wichtig ist dabei, dass der Lebensraum (Brachen, Wildwiesen) wenig gestört wird und dass die Vegetation langfristig stehen bleibt, denn sonst werden die Netze zu häufig zerstört. Die Spinne kann ihr Netz zwar jederzeit erneuern (Netzbau findet meist in den Dämmerungsstunden statt), wandert aber aus dem betreffenden Lebensraum ab, wenn das zu häufig nötig ist. Das Netz der Wespenspinne unterscheidet sich vom Netz der Kreuzspinne vor allem dadurch, dass hier oberhalb und unterhalb der Netzmitte (Nabe) ein dichtes Zickzackgeflecht eingebaut wird.
Radnetze sind wahre Kunstwerke der Natur. Die Spinnseiden, die dabei zum Einsatz kommen, sind allesamt Eiweissprodukte. Ihre technischen Eigenschaften (Festigkeit wie Glas bei gleichzeitiger Elastizität wie Nylon) faszinieren auch Ingenieure immer wieder. Diese elastische Reissfestigkeit ist nötig, denn die Netze sollen auch grosse Insekten in ihrem Flug abfangen können ohne zu zerreissen. Es kommen verschiedene Seidentypen mit unterschiedlichen Eigenschaften zum Einsatz: Die Rahmenfäden sind besonders reissfest, während die Fangspirale mit Leimtropfen besetzt ist und beim Einwickeln der Beute kommen richtige Seidenbänder zum Einsatz.
In einem optimalen Lebensraum (z.B. Halbtrockenrasen) kommen die Wespenspinnen in grosser Dichte vor. Eine Untersuchung in Deutschland (nahe Jena) hat ergeben, dass alleine die Wespenspinnen pro Hektare Wiese rund 4,5 Mio Arthropoden pro Jahr vertilgen, was rund 80 kg Frischmasse entspricht. Hauptbeutetiere sind dabei Heuschrecken und Hautflügler. Wespenspinnen und Spinnen allgemein haben mit diesen enormen Vertilgungsraten in einem natürlichen System eine überaus grosse Bedeutung bei der Limitierung der Populationsdichten von Insekten.
Spinnen legen ihre Eier in Kokons ab, welche je nach Art ganz unterschiedlich aussehen und unterschiedlich betreut werden. Wolfspinnen z.B. tragen die Kokons und später auch die Jungtiere mit sich herum und fangen auch für die Jungtiere Beute. Die Wespenspinne kann mehrere Kokons produzieren, welche sie dann in der Vegetation rund um das Netz aufhängt und einige Zeit bewacht. Später wird der gut geschützte und getarnte Kokon sich selbst überlassen. Die Jungspinnen schlüpfen erst im nächsten Frühjahr, wenn das Muttertier schon lange gestorben ist.
Weitere Informationen über die Lebensweise und Besonderheiten zur Wespenspinne sind auf der Homepage der Arachnologischen Gesellschaft e.V. (www.arages.de) zu finden. Dort wird demnächst auch eine aktuelle Verbreitungskarte der Wespenspinne für das Bundesgebiet zu sehen sein. Zu diesem Zweck ruft die Arachnologische Gesellschaft e.V. dazu auf, unpublizierte Funde zu melden, um ein genaues Bild über die Verbreitung der Spinne zu erhalten.
2. Spinnseide ist nicht einfach Spinnseide!
Die Spinnseide der Spinnen ist ein ausgesprochen faszinierender Werkstoff. Seine Zugfestigkeit ist in etwa mit jener von Glas zu vergleichen, jedoch bei einer ausgesprochen grossen Elastizität (etwa wie Nylon). Diese Kombination von Festigkeit und Elsatizität ist einmalig und bis heute technisch nicht erreicht. Wenn im Gegensatz zur Naturseide der Seidenraupen die Spinneseide der Spinnen nicht industriell genutzt wird, so hängt das damit zusammen, dass die Produktion nicht so einfach möglich ist: Spinnen sind Räuber - für eine Zucht müssten also zusätzlich noch Beutetiere gezüchtet werden - und Spinnen liefern nicht so schön abwickelbare Einzelfäden, wie dies die Seidenspinnerraupen tun.
Allerdings ist Spinnseide auch nicht einfach gleich Spinnseide, sondern es gibt je nach Verwendungszweck unterschiedliche Seiden mit unterschiedlichen Eigenschaften. Am schönsten lässt sich dies beim Kokonbau der Wespenspinne zeigen:
 |
 |
 |
||
| 1. Das trächtige Weibchen mit prall gefülltem Hinterleib beginnt den Kokonbau. Ein Boden aus weisse, zäher Seide wird in die Vegetation gehängt. | 2. Mit einem anderen Seidentyp (braun) werden seitliche Wände gebaut. Ein nach unten offener "Becher" entsteht. |
3. Von unten wird ein gelblicher Eiballen |
||
 |
 |
 |
||
| 4. Braune, weiche Spinnseide wird um den "Becher" und die Eier gesponnen - eine Polster- und Isolationswatte | 5. Die Eier müssen vor Nässe geschützt werden. Ein pergamentartige, weisse Schicht Seide hilft hierbei. | 6) Die weisse Schicht fällt zu fest auf, Räuber wie Vögle z.B. würden den Kokon zu leicht entdecken. Mit verschieden-farbigen Spinnseiden wird der Kokon getarnt. Viele lose gespannte Fäden hindern zudem Parasiten vor dem Zutritt zum wertvollen Gelege. Der Hinterkörper der Spinne ist nach dem Kokonbau stark geschrumpft (Eier und viel Seide abgegeben). |

In der halb vertrockneten Vegetation im Herbst und Winter sind die vielen Kokons gut getarnt.
Bildnachweis
Jakob Walter, Neuhausen (Kokonbau)
Johannes Spaar, Nunningen (erstes Bild)
Kontaktadresse des Authors:
Ambros Hänggi
Naturhistorisches Museum Basel
Abt. Biowissenschaften
Augustinergasse 2
4001 Basel
Tel. 061 266 55 11
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
http://www.nmb.bs.ch
Internet-Adressen zu Spinnen
| http://www.arages.de/ | Arachnologische Gesellschaft e.V. |
| International Society for Arachnology |
Spinnen
Spinnen sind faszinierende Tiere und ist eine verkannte Tierart
Hier dürfen wir auf das Fachwissen von A. Hänggi zurückgreifen.
Er stellte uns die folgenden Texte der jeweiligen Spinnen des Jahres zur Verfügung.
Huschspinne
| Spinne des Jahres 2004 Proklamation durch die Arachnologische Gesellschaft e.V. (AraGes) am 09.01.2004 www.arages.de Bild rechts Zur Feindvermeidung können Spinnen die Beine abwerfen - so hat auch dieses Männchen durch opfern eines Beines das Zupicken eines Vogels überlebt . |
 |
| © Foto Jakob Walter |
Grüne Huschspinne - Micrommata virescens (Clerck 1757)
Die Grüne Huschspinne wurde von der Arachnologischen Gesellschaft (Vereinigung zentraleuropäischer SpinnenforscherInnen) zur Spinne des Jahres 2004 gewählt. Spinnen haben im Allgemeinen ein sehr schlechtes Image als hässliche, giftige Tiere. Mit der Grünen Huschspinne, einer ausgesprochen schönen, kräftig grün (Weibchen) oder grün-gelb-rot (Männchen) gefärbten Spinne wollen die Spinnenforscherinnen und -forscher zeigen, dass dieses Image der Hässlichkeit keineswegs stimmt.
Besonders reizvoll ist die Grüne Huschspinne für Spinneninteressierte aufgrund ihrer prächtigen Färbung. Vorderkörper und Beine sind bei Männchen und Weibchen einheitlich leuchtend grasgrün. Der Hinterkörper der Tiere ist ein hervorragendes Unterscheidungsmerkmal für beide Geschlechter. Das Weibchen besitzt auf seinem grünen Hinterleib einen gelblich abgesetzten grünen Spießfleck. Das Männchen dagegen ist gekennzeichnet durch einen leuchtend roten Längsstreifen, der beiderseits eingefasst ist von gelben Streifen. Die Seiten des Hinterleibs sind wiederum in prachtvollem Rot gefärbt. Die typischen Farben und Merkmale der Grünen Huschspinne stellen sich erst nach der letzten Häutung, der sogenannten Reifehäutung, ein. Die Jungtiere besitzen eine große Farbvariabilität. Zu beobachten sind grünliche oder bräunliche Tiere, die mit dunkleren Punkten versehen sind und so häufig dem Untergrund farblich gleichen und somit gut getarnt sind. Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Körperlänge, die bei Weibchen 12-15 mm und bei Männchen 7-10 mm beträgt. Ausgewachsene Tiere findet man von Ende April bis Juni, Weibchen zum Teil auch länger bis Ende Juli. Die Tiere überwintern als spätes Jugendstadium, die letzte Häutung (Reifehäutung) mit dem Farbwechsel findet erst im Frühjahr statt.
Man könnte meinen, ein so auffällig gefärbtes Tier müsse leicht im Gelände zu entdecken sein. Doch in ihrem natürlichen Umfeld lässt ausgerechnet diese Färbung das Tier beinahe unsichtbar werden. In den unteren Bereichen von besonnten Gebüschen oder im Gräsergewirr feuchter Wiesen wird sie Eins mit den Farben und Strukturen ihrer Umgebung. Dadurch kann sie sich nicht nur vor Feinden, wie etwa Vögeln, schützen.
 |
 |
|
| Grüne Huschspinne (Micrommata virescens) Männchen © Foto Jakob Walter |
|
Grüne Huschspinne (Micrommata virescens) Weibchen auf Brombeerblatt, © Foto Albert Krebs |
Das Paarungsverhalten der männlichen Tiere ist vorwiegend im April und im Mai zu beobachten. Das Männchen läuft im Zickzack umher, um sich nach kurzer Zeit auf die Hinterbeine zu stellen und tänzelnd, um die eigene Achse kreisend, die Umgebung abzutasten. Dieses Ritual wird wiederholt, bis es auf ein Weibchen stößt. Augenblicklich beklopft das Männchen mit den Vorderbeinen den Rücken des weiblichen Tieres. Lässt es das Weibchen zu, beginnt nun die mehrere Stunden dauernde Paarung.
Nach einiger Zeit baut das Weibchen eine geräumige Eikammer aus zusammengesponnenen Blättern, in die es ihre grünen Eier legt. Die Eikammer wird bis zum Schlupf der Jungspinnen bewacht. Auch in den ersten Jugendphasen begleitet das Muttertier noch ihre Jungen.
Die Grüne Huschspinne zählt zu den Riesenkrabbenspinnen (Sparassidae). Sie ist die einzige bei uns vorkommende freilebende Art dieser sonst vorwiegend in den Tropen und Subtropen verbreiteten Familie. Im Mittelmeerraum gibt es eine weitere Art, die Mittelmeer-Huschspinne M. ligurinum. Eine Ausnahme ist die in Gewächshäusern verbreitete Heteropoda venatoria (die sogenannte "Bananenspinne"), die zur selben Familie gehört.
Die Grüne Huschspinne ist in der Schweiz ausser in der alpinen Stufe überall anzutreffen, wobei wärmere Lagen klar bevorzugt werden. Dementsprechend nimmt ihre Häufigkeit innerhalb Europas gegen den Norden hin deutlich ab. Sie ist tagaktiv und besonders wärme- und sonnenliebend. Anzutreffen ist diese Art vorwiegend auf extensiv oder nicht bewirtschafteten Feuchtwiesen, in Lichtungen von Laubwäldern und an sonnigen Waldrändern. Sie lebt am Boden, klettert aber auch gerne auf Gräsern und Kräutern herum.
Wie bei vielen Tier- und Pflanzenarten in Deutschland geht ihre Bedrohung von dem verschwinden geeigneter Lebensräume aus. Vor allem Brachen und Randstreifen sind wichtige Habitate, die von der Grünen Huschspinne besiedelt werden.
 |
Grüne Huschspinne (Micrommata virescens) Männchen © Foto Jakob Walter Zur Feindvermeidung können Spinnen die Beine abwerfen - so hat auch dieses Männchen durch opfern eines Beines das Zupicken eines Vogels überlebt |
Das Autorenteam
Arachnologische Gesellschaft (Martin Kreuels, Peter Jäger und Ambros Hänggi).
Kontaktadresse:
Ambros Hänggi
Naturhistorisches Museum Basel
Abt. Biowissenschaften
Augustinergasse 2
4001 Basel
Tel. 061 266 55 11
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
http://www.nmb.bs.ch
Internet-Adressen zu Spinnen
| http://www.arages.de/ | Arachnologische Gesellschaft e.V. |
| International Society for Arachnology |
Zebraspringspinne
|
|
 © Foto Barbara Knoflach |
Zebraspringspinne (Salticus scenicus), Männchen mit deutlich verlängerten Kieferklauen |
Während die übrigen sechs Augen fast nur schemenhaft Bewegungen wahrnehmen können, sind diese grossen vorderen Mittelaugen äusserst leistungsstark: Mit diesen Augen können die kleinen Spinnen nicht nur genau feststellen, was genau sich bis auf eine Distanz von etwa 20 cm vor ihnen aufhält, sie können auch die Distanz bis zu diesem Objekt genau abschätzen. Dazu können sie nicht wie wir Menschen die Augen bewegen und so aufgrund der Auslenkung der Augäpfel die Distanz berechnen, sondern sie verändern mit Muskelkraft die Brennweite der Augenlinsen: Aus dieser Veränderung bis zur Scharfstellung des Bildes kann die Spinne die Distanz "berechnen". 
Zebraspringspinne (Salticus scenicus), Portrait mit den riesigen vorderen Mittelaugen. Foto © Maja Schwarzenbach
Dies ist für die Springspinnen, zu denen auch die Zebraspringspinne gehört, lebenswichtig. Wie alle Spinnen sind auch die Springspinnen Räuber, die sich von anderen Kleintieren, vor allem Insekten aber auch anderen Spinnen ernähren. Während die meisten Spinnen für den Beutefang Netze in verschiedenster Form einsetzen, sind die Springspinnen Jäger, welche auf Beute lauern und diese dann auf Distanz anspringen und mit einem Giftbiss überwältigen - eine Jagdtaktik, die nur Sinn macht, wenn man zielgenau springen kann, also die Distanz abschätzen kann.
Die Zebraspringspinne, mit dem wissenschaftlichen, lateinischen Namen Salticus scenicus, gehört zu einer der grössten Spinnenfamilien, den Springspinnen: Von den rund 38'000 bekannten Spinnenarten weltweit gehören etwa 4'000 zu dieser Familie und rund 100 davon kommen in Mitteleuropa vor. Die für die Zebraspringspinne typische schwarz-weisse Färbung zeigen in Mitteleuropa vier Arten der Gattung Salticus mehr oder weniger deutlich. Das Farbmuster wird durch verschiedenfarbige Schuppenhaare gebildet. Diese Haare können zum Teil wegbrechen, sodass die Färbung bei älteren Tieren immer undeutlicher wird.
Die Zebraspringspinnen lassen sich an Frühsommertagen sehr leicht an sonnigen, warmen Stellen beobachten. Hat man eines der kleinen Tierchen entdeckt, so kann man mit ihnen spielen! Hält man einen kleinen Gegenstand oder den Finger zehn bis zwanzig Zentimeter vor das Tierchen hin und bewegt ihn seitwärts, so wird die Spinne ihren Vorderkörper immer danach ausrichten. Die Spinne kann ja die Augen nicht bewegen, muss also den Körper nach dem Objekt ausrichten, wenn sie genau erkennen will, was sich da vor ihr bewegt.
| Wir können aber mit unseren Spielchen auch etwas "gemeiner" werden und dabei eine andere, äusserst interessante Sache entdecken. Wenn wir die Spinnen z.B. auf einem Tisch entdecken, so können wir sie gegen den Rand hin wegjagen. Sie wird immer weiter davon hüpfen (Springspinne!) bis sie irgendwann über den Tischrand hinausspringt. Was jetzt passiert, ist überraschend: die Spinne fällt nicht etwa zu Boden, sondern bleibt etwa 20 bis 30 cm unter der Tischkante in der Luft stehen, bleibt da einige Sekunden in der Luft und krabbelt dann wieder zum Tisch hoch. Jede Spinne spinnt immer eine Sicherheitsleine hinter sich her - gerade für Springspinnen, die auch mal ins Leere springen können, eine sehr wichtige Einrichtung. Wenn wir viel Geduld und ein wenig Glück haben beim Beobachten, können wir auch das Paarungsverhalten oder die "Kämpfe" rivalisierender Männchen beobachten. Winkbewegungen mit den Tastern und komplizierte Tanzmuster (jede Art hat ihre eigenen Tänze) zeigen uns, dass wir es mit einem Balzverhalten zwischen Männchen und Weibchen zu tun haben. Gehen die beiden Partner aber aufeinander los und vollführen einen Ringkampf, indem sie sich mit den übergrossen Kieferklauen ineinander verhaken, so haben wir es mit zwei rivalisierenden Männchen zu tun, welche um die Vorherrschaft im Territorium kämpfen. Die Zebraspringspinne wurde von der Arachnologischen Gesellschaft (www.arages.de) und der belgischen arachnologischen Gesellschaft (www.arabel.ugent.be) zur Spinne des Jahres 2005 gewählt. Mit dieser internationalen Aktion soll über die deutschsprachigen Grenzen hinweg eine Art stellvertretend für die über 1'300 zentraleuropäischen Spinnenarten der breiten Öffentlichkeit bekannter und beliebter gemacht werden.  Das Autorenteam Arachnologische Gesellschaft (Martin Kreuels, Peter Jäger und Ambros Hänggi). Kontaktadresse: Ambros Hänggi Naturhistorisches Museum Basel Abt. Biowissenschaften Augustinergasse 2 4001 Basel Tel. 061 266 55 11 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! http://www.nmb.bs.ch Internet-Adressen zu Spinnen
|
||||||||
Totenkopfschwärmer
Diese seltene Raupe wurde im warmen Sommer in Büsserach gefunden. Eine Bilddokumentation
| 1. Unser Fund in Büsserach im Sommer 2003 17. Juli 2003 Ernst Gisin findet diese Raupe in seinem Er bringt sie Ewald Dreier... |
 |
| 19. Juli 2003
Karli Giger findet diese Puppe beim Ausgraben von Kartoffeln in seinem Pflanzgarten Gehrenstrasse. Er bringt sie Hans Rüfli |
 |
| 19. Juli 2003
Beide liegen nun in einem Vivarium bei Ewald unter der Erde. Die Raupe musste zum Fotografieren nochmals ausgegraben werden. Wir verfolgen den weiteren Ablauf. |
 |
 |
Die Behausung: Erde, Futterpflanzen, Schale mit Wasser und gefüllter Honigwaben 25. August 2003 Der erste Falter ist geschlüpft  |
 |
 |
| Leider sind die Vorderflügel nicht richtig ausgebildet, vermutlich zuwenig Feuchtigkeit. Der Falter kann nur ca. 20 cm fliegen Am 6. September 2003 ist der zweite Falter geschlüpft. Leider konnte ich diesen nicht fotografieren, nach dem Entfernen des Gitters ist er auf und davon |  |
2. Dokumentation über den Totenkopschwärmer
| Schwärmer | Die Familie der Schwärmer spielt eine besondere Rolle unter den Nachtfaltern. Es sind meist sehr große Falter mit dickem Körper, die oft kolibriartig im Schwirrflug vor Blüten stehend beobachtet werden.Wenn man geeignete Pflanzen (Geißblatt (Lonicera spec.), Nachtkerzen (Oenothera spec.), Seifenkraut (Saponaria spec.), Phlox (Phlox paniculata), ...) im Garten hat, bekommt man sie am ehesten zu Gesicht. Häufiger als die Falter findet man die großen Raupen, die meist am Körperende eine Art Stachel (völlig ungefährlich!) haben. Da man die Falter anders kaum in Ruhe beobachten kann, empfehle ich, gefundene Raupen zu züchten, was gar nicht so schwierig ist. Näheres zur Schwärmerzucht findet man unter dem Link Zucht auf der Webseite http://www.schmetterling-raupe.de/ (vor allem im Abschnitt I2). |
| Größe/Häufigkeit | Sehr großer Falter, dessen Häufigkeit jahrweise je nach Einwanderungsgrad unterschiedlich ist, der aber eher vereinzelt vorkommt. Funde sind immer bemerkenswert und sollten unbedingt gemeldet werden! Fotobeleg erwünscht, falls der nicht möglich ist, Tier genau beschreiben. |
| Verbreitung/ Biotop/ Flugzeit: | Der Falter war früher gut an die extensivere Agrarwirtschaft angepasst, hat aber mit den modernen Anbaumethoden sicherlich Probleme. Die eingewanderten Falter kann man - sehr selten - im Sommer antreffen, die Falter, die sich bei uns entwickelt haben vor allem von Ende August bis Anfang November. |
| Ähnliche Arten: | Die Raupe ist unverwechselbar, vor allem wegen des gelben Horns (s.o.), welches aber nicht so glatt ist wie bei den anderen Schwärmerraupen. Auch der Falter ist durch die deutliche Totenkopfzeichnung eigentlich nicht zu verwechseln. |
| Raupenfutterpflanzen: | Meist Kartoffel (Solanum tuberosum), gelegentlich Liguster (Ligustrum spec.), vereinzelt auch Sommerflieder (Buddleja davidii). Hier soll demnächst eine Liste der mir durch Internetmeldungen bekannt geworden gesicherten Raupenfutterpflanzen erstellt werden : |
| Überwinterung | Gelegentlich dringen Falter in Bienenstöcke ein, um dort Honig zu saugen. Wie der Totenkopfschwärmer gehören auch andere Schwärmer zu den Wanderfaltern (Taubenschwänzchen, Windenschwärmer). Falter und Raupen des Totenkopfschwärmers und des Windenschwärmers sollten unbedingt gemeldet werden! http://www.schmetterling-raupe.de/ |
| Systematik: | Sphingidae - Schwärmer |
| Bemerkungen: | Diese Seiten mit den Arten-Portraits richten sich vor allem an interessierte Laien und Fortgeschrittene, so dass Manches vereinfacht und sehr verkürzt dargestellt wird. Für Kommentare und Korrekturen bin ich stets dankbar! Bezüglich der Namen richte ich mich bei in Deutschland vorkommenden Tagfaltern nach Settele/Feldmann/Reinhardt, Die Tagfalter Deutschlands, bei den sonstigen Arten nach Karsholt/ Razowski, The Lepidoptera of Europe. Andere gebräuchliche Namen setze ich in Klammern |

Grossaufnahme der Kopfpartie mit dem imposanten Auge.
Einiges weiteres Wissenwertes zu den Raupen des Totenkopschwärmers
Überwinterung:
Puppen, die im Spätherbst nicht mehr schlüpfen, erfrieren im Boden. Eine Überwinterung dieses Wanderfalters bei uns in irgendeinem Stadium dürfte kaum möglich sein.
Bienenstöcke
Gelegentlich dringen Falter in Bienenstöcke ein, um dort Honig zu saugen. Wie der Totenkopfschwärmer gehören auch andere Schwärmer zu den Wanderfaltern (Taubenschwänzchen, Windenschwärmer). Falter und Raupen des Totenkopfschwärmers und des Windenschwärmers im unser Region sollten uns unbedingt gemeldet werden!
Weiterführender Link
Dazu besuche man die Seite
http://www.schmetterling-raupe.de/
Zusammenstellung: Ewald Dreier
Schwalbenzug
| Wegzug der Schwalben Ein kleiner Bericht zum Wegzug der Schwalben, welcher immer um den 8. September stattfindet. Die beiden Gedichte über die Schwalben unseres Mundartdichters Willy Ackermanns gibt die spezielle Symbolkraft dieser Tiere wieder. Wenn die Schwalben wegziehen, fehlen die eleganten Flugkünstler am Himmel. Ebenso ist es ein untrügliches Zeichen, dass der Sommer vorbei ist. Der Bericht ist mehrteilig und umfasst die Gedichte, kurzer Steckbrief über unsere wichtigten Schwalben und deren Wegzug und Rückflug. Ein altes Sprichwort sagt: |
 |
| Am 8. September isch Maria Geburt, ... und denn fliege d' Schwalbe furt. |
1. Kurzgedichte (veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von Willy Ackermann)
wenn d'Schwalbe furtgöö
wenn-sy chömme,
das beschäftigt vieli Lüt,
doch s'gid au setig,
au das sy vieli,
dene seit das alles nüd
2. Wegzug (veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von Willy Ackermann)
Im Herbscht sy d'Schwalbe
Richtung Afrika gfloge,
Doch ä Mächt - ä ganz heime
Duet-se au dört ä bitz bloge
Doch worum mir öisi Fründe
Ufsmol wieder gseh "jage",
Wie-sy turne und d'Müggli
Grad z'tousige
Zue-de Junge düe trage ?
Worum das so isch
Das muesch s'Schwalbenvolk
froge !
sy würde dir säge:
s sig hald wieder sowit,
i dämm Ländli das wyt äne Lyt
sig wieder einisch
das grosse Wunder im gang,
S'Summerwärde a dr Birs
und im Schwarzbuebelang!
im Herbscht heige-sy
d'Näschtli schön suber verloo,
heige no gseid zue-de "Buure",
mir sy denn gly wieder doo !
Und genau vo dämm Ort
Wie au die Junge "dr Schyn",
dört schtech schwarz uf wiss druff,
Dass für d'Heimetflüg alli"
Immer Türe sig uff !
Und was d'Eltere hei triebe,
(schtod au nirgends gschriebe)
Ime-ne ganz chline Sätzli inn lits:
Dr Heimetort vo dä Schwalbe
Das isch und bliibt d'Schwizz !
|
Wegzug der Schwalben |
 |
Ein kleiner Bericht zum Wegzug der Schwalben, welcher immer um den 8. September stattfindet. Die beiden Gedichte über die Schwalben unseres Mundartdichters Willy Ackermanns gibt die spezielle Symbolkraft dieser Tiere wieder. Wenn die Schwalben wegziehen, fehlen die eleganten Flugkünstler am Himmel. Ebenso ist es ein untrügliches Zeichen, dass der Sommer vorbei ist.
Der Bericht ist mehrteilig und umfasst die Gedichte, kurzer Steckbrief über unsere wichtigten Schwalben und deren Wegzug und Rückflug.
1. Kurzgedicht (Willy Ackermann)
2. Gedicht Wegzug (Willy Ackermann)
3. Mundartgedicht Dr Schwalbezug (Willy Ackermann)
4. Öisi Schwalbe (Willy Ackermann)
5. Mehlschwalbe und Rauchschalbe (Kurzbeschrieb)
1. Kurzgedichte (veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von Willy Ackermann)
wenn d'Schwalbe furtgöö
wenn-sy chömme,
das beschäftigt vieli Lüt,
doch s'gid au setig,
au das sy vieli,
dene seit das alles nüd
2. Wegzug (veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von Willy Ackermann)
Im Herbscht sy d'Schwalbe
Richtung Afrika gfloge,
Doch ä Mächt - ä ganz heime
Duet-se au dört ä bitz bloge
Doch worum mir öisi Fründe
Ufsmol wieder gseh "jage",
Wie-sy turne und d'Müggli
Grad z'tousige
Zue-de Junge düe trage ?
Worum das so isch
Das muesch s'Schwalbenvolk
froge !
sy würde dir säge:
s sig hald wieder sowit,
i dämm Ländli das wyt äne Lyt
sig wieder einisch
das grosse Wunder im gang,
S'Summerwärde a dr Birs
und im Schwarzbuebelang!
im Herbscht heige-sy
d'Näschtli schön suber verloo,
heige no gseid zue-de "Buure",
mir sy denn gly wieder doo !
Und genau vo dämm Ort
Wie au die Junge "dr Schyn",
dört schtech schwarz uf wiss druff,
Dass für d'Heimetflüg alli"
Immer Türe sig uff !
Und was d'Eltere hei triebe,
(schtod au nirgends gschriebe)
Ime-ne ganz chline Sätzli inn lits:
Dr Heimetort vo dä Schwalbe
Das isch und bliibt d'Schwizz !
3 Dr Schwalbezug (veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von Willy Ackermann)
Wenn d Schwalbe gschlosse südwärts fliege
nie gsesch eini ganz älei,
düe-sy d Drööt fascht dure-biege
Apäll bi furtgo - au für hei
A Maria Geburt isch es meischt sowit
dr Zugchef seid: gly isch-es Zyt,
Doch wird no gwartet uf die Junge
die sich no sterke für Flug -
Äs wird no zwitscheret - no wird gsunge
denn schwingt sich uf ä lange Zug,
winke lang no mit dä "Facher" !
und fliege no ä Schleife über d Dächer !
"Rächt guete Flug ihr liebe Schwalbe
richtet Grüess us z Afrika
grad wenn-dr a öis danked - albe
und no dr Schwizz düet Heimweh ha" ...!
Doch d Zyt vergood - au die zieht dure
s wird gsammlet scho zum "Retourflug",
ä dunkle Strich zieht gege d Alpe
dr Schwizz zue fliegt dr Schwalbezug !
D Heimet - das sy für sii doch d Näschtli
müehsam bout mit Schtrau und Sang,
"isch s ächt no ganz" - dänkt s "Schwalbe-Meitschi"
oder lit s am Bode - ächt scho lang ?
Sitz-isch denn Zobe ufem Bänkli
luegsch dört verträumt dä Chraije noo,
gsesch plötzlich ä bekannte Segler
rüefsch freudig i d Schtube: hee - d Schwalbe sind doo !
Öisi Schwalbe
Dr Summer hed mit letschter Chraft
sy "Durchschnitts-Hitz" no einisch gschafft
die letschte Tropfe vo dr Schtirne
sy lö-di scho vill freijer "Hirne" !
Fascht über Nacht isch es chaelter worde
ä böse Schneeluft wäijt vo Norde
di Herbschtzitlose beherrsche s Fäld
s god em Jooresänd zue -
das isch hald im Herbscht sy Wält !
Dr Schneeluft schtricht-ne über d Chöpfli
bloost us dä Chelch die letschte Tröpfli,
au d'Schwalbe gschpüre "s Reisefieber"
sy tanze "Tango - Walzer - Schieber" !
um denn doch zwüsche-ine-wie s öbbe so good
ä bitz z verwile ufeme "Droot" !
Doch gly scho wieder düe-sy schtarte
zum grosse "Blindflug" ohni Charte !
si bruche kei Charte - sy wüsse wo-hie
sy sii jo paarmol "dört äne gsy"
wenn s by öis chalt wird - isch s dört äne schön heiss
bring-mer einisch ä Schwalbe - wo das nid gnau weiss!
doch wie-sy furt göö - god au d'Reis wider zrugg.
sy bruche kei Schiff - kei Schtross - kei Brugg,
sy fliege dodsicher dr "Gotthard" aa
und jedes Schwalbeli isch schtolz - dass äs das au chaa!
Doch denn ame-ne Obe - vorem Hus ufs Bänkli
Bringt so-ne Schwalbe dir ä Gschänkli
äs fliegt im Tiefflug a dir vorby
Zeigt däwäg dir d Freud - daheim wieder z sii !
Au d'Näschtli sy so guet wie nöi
Also los mit brüete - gar chly isch s Herbscht
Wo dr START wider chunnt - "wo s im Sang zue göi !
Welche Schwalbenarten sind im Schwarzbubenland / Laufental am meisten zu beobachten
Die Mehl- und die Rauchschwalbe, wobei die Mehlschwalbe ist häufiger zu beobachten als die Rauchschwalbe. Vereinzelt kann die Felsenschwalbe beobachtet werden,
| Mehlschwalbe Die Oberseite ist schwarz mit evtl. leicht bläulichem Stich und mit einem weissem Bürzel; Die Unterseite ist weiss und der Schwanz ist kürzer und weniger gegabelt als bei der Rauchschwalbe; beide Geschlechter sehen gleich aus; die Mehlschwalbe brütet in der Regel an den Gebäudefassaden. Ein Mehlschwalbe wird 12 cm lang und wiegt bis 21 g. Sie ist ein Langstreckenzieher und überwintert in Afrika. |
 |
|
| Die Rauchschwalbe Die Oberseite ist stahlblau; Die Brust und Stirn ist kastanienbraun; der visuell grösste Unterschied ist im lang gegabelten Schwanz mit den langen Spiessen zu beobachten. Dieser ist bei Weibchen und Jungvögeln wenig kürzer; sie brüten in der Regel im Innern von Gebäuden, deshalb an dieser Stelle ein Danke an die Hausbewohner (Bauern) die den Rauchschwalben durch offene Türen ein zu Hause ermöglichen. Die Rauchschwalbe ist Vogel des Jahres 2004 des Schweizerischen Vogelschutzes. Eine Rauchschwalbe wird bis 19 cm lang und wiegt bis 25 g. Sie ist ein Langstreckenzieher und überwintert in Afrika. |
 |
Wegzug
Der Wegzug unserer Schwalben beginnt Ende August / anfangs September. Die Schwalben ziehen Richtung Südfrankreich - Spanien - Mittelmeer - Sahara und überwintern in West- oder Zentralafrika.
Rückflug
Der Rückflug beginnt im Februar und die Ankunft ist ca. Mitte März der ersten Rauchschwalben und Ende März die der Mehlschwalben. Der Hauptharst trifft später, meist Mitte April ein. Einige Nachzügler, vor allem Junge treffen sogar später noch ein.
Der Rückflug geschieht in der Regel eiiges schneller als der Wegzug. Sie legen diese Strecke in kurzer Zeit zurück. Tagesstrecken im Durchschnitt von grösser 300 km pro Tag sind keine Seltenheit.

Schwalben bei der Besammlung
Autoren
| - Willy Ackermann |
| - Ruth Meury |
| - Markus Christ |
Seidenschwanz
|
Den Seidenschwanz konnte ich mehrere Male beobachten. Jedesmal eine spezielles Erlebnis. Vor allem das "Zirpen" der Vögel ist sehr artspezifisch und die Hälfte der Beobachtungen konnte ich dank dem Gehör machen. |
 |
|
| Seidenschwanz beim Verzerren einer Hagebutte © Foto Markus Christ |
Beobachtung in der Naturregion
Die Seidenschwänze konnten mehrfach in Büsserach an der von Natur- und Vogelschutzverein Büsserach bepflanzten Hecke am Marchenmattweg beobachtet werden. Ebenso wurden in Erschwil (Gruppe von 50 Vögeln) Seidenschwänze beobachtet. 
... bei der Malzeit bei unserem Präsidenten Hans Rüfli bei dessen Abwesenheit im Garten ...
Besammlung wie die Schwalben !
Meine erste Begegnung am 24.12.2004 - 6 Seidenschwänze auf einem Bild

Alle Aufnahmen sind in der Naturregion entstanden, diese Bilder sind auf Grund des trüben Wetters leider nicht von allzu berauschender Qualität.
Text und Bericht Markus Christ
tierische Rekorde
Einzelne Tiere sind Rekordhalter - es geht hier nicht darum die Tiere zu krönen, sondern aufzuzeigen was diese leisten.
Erhalten wir diese alle!
Einige Beispiele
|
-
|
Der winzige Mausmaki zum Beispiel: der Halbaffe ist Weltmeister im Energiesparen – ein Vorbild für alle Menschen... |
|
-
|
Dieses kleinste Äffchen der Welt ist nur etwa 15 Zentimeter gross. Es kann seinen Stoffwechsel extrem reduzieren. Dabei sinkt seine Körpertemperatur auf 20 Grad – und das Tierchen verbraucht bis zu 40 |
|
-
|
Die 50 Gramm schweren Mausmakis (Microcebus murinus) sind in Madagaskar zu Hause. Die kleinen Lemuren sind nachtaktiv (daher die grossen Augen) und verbringen den Tag in ihrem Nest in hohlen |
|
-
|
Wanderfalken erreichen im Sturzflug bis 320 km/h. Im Horizontalflug (100 km/h) werden sie aber locker von Brieftauben und Mauerseglern (180 km/h) überholt. |
|
-
|
Der längste Wurm der Welt ist der 30 Meter lange Schnurwurm. |
|
-
|
Küstenseeschwalben legen die längste Strecke pro Jahr zurück: 36 000 km. |
|
-
|
Grösstes Tier der Erde ist der Blauwal mit 33 m Länge und 130 Tonnen Gewicht. |
|
-
|
Sperbergeier fliegen 11 200 m hoch. Bis heute weiss man nicht, wie sie es in dieser extrem sauerstoffarmen Höhe aushalten. |
|
-
|
Der Strauss ist der grösste Vogel. Er sprintet locker mit 70 km/h dahin. |
|
-
|
Das Faultier ist das langsamste Säugetier: In einer Stunde schafft es nur 300 Meter. |
|
-
|
Die meisten Augen hat die Libelle – nämlich 40 000. |
|
-
|
Die meisten Nachkommen hat die Stubenfliege: 5,6 Milliarden pro Jahr. |
|
-
|
Der nur drei Zentimeter grosse dreistachlige Stichling kommt im Meer in Küstennähe in Schwärmen von mehr als 500 Milliarden Tieren vor |
Nationalpark
 |
Im Nationalpark am 3.10.2005 viel Schnee ... |
|
 |
Am 4.10.2005 Wanderung bei schönstem Wetter ins Val Trupchun. Wettervorhersage: einige Niederschläge !!! |
|
 |
Steinbock beim Blick durchs Fernrohr | |
 |
Gämsen im Schnee | |
 |
Alpendohle ! | |
 |
Viva la Grischa .... | |
 |
2 Hirsche in einer Waldschneise .. | |
 |
Wanderung nach Margunet der Wiege des Bartgeiers ! |
|
 |
Herrliche Landschaft zum Margunet | |
 |
Gämsen in weiter Entfernung | |
 |
An Stelle eines Bartgeiers ein Steinadler in luftiger Höhe |
|
 |
Ein einsamer Buchfink ... | |
 |
Am 6.10.2005 - Wanderung zur Alp Grimmels |
|
 |
Welche Farben ... | |
 |
Dann kam er ... in gut 500 m Höhe Ein Kolkrabe machte auf ihn aufmerksam, den grössten Vogel am Schweizer Himmel den Bartgeier man beacht den Grössenvergleich zu der Kolkrabe, die nur unwesentlich höher flog ! |
|
 |
Gewaltig .... Bei seinen Kreisen über die Alp Grimmels ... |
|
 |
Lärche in den Herbsfarben ... | |
Fotos: Sarah und Markus Christ